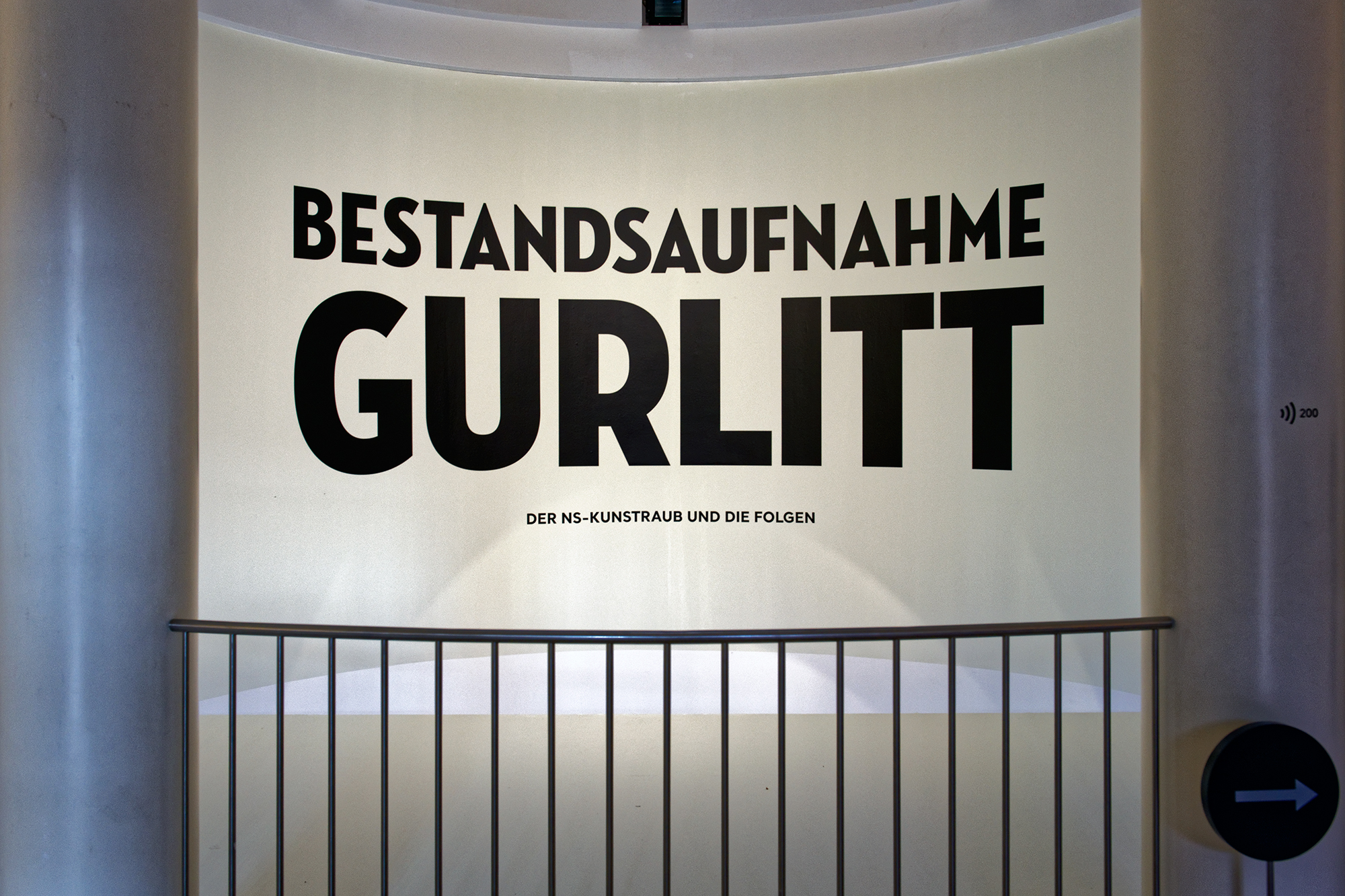Welterfolg wird fortgeführt
Es geht endlich weiter: Ab 19. Februar 2018 werden weitere sechs Folgen einer der erfolgreichsten Serien weltweit im deutschen Fernsehen gezeigt – der Blaue Planet. Jeweils montags nach der Tagesschau um viertel nach acht können sich die Zuschauer in die Tiefen der Ozeane und an deren Küsten entführen lassen. Bei dieser zweiten Staffel wurde die BBC von einer Allianz aus WDR, BR, NDR und SWR unterstützt. Der Schauspieler Axel Milberg kommentiert die fantastischen Bilder. Hans Zimmer liefert die Musik.
Die BBC hat sich mit ihren Natur- und Tierfilmen einen Namen gemacht. Das verdankt sie dem heute einundneunzigjährigen David Attenborough, Bruder des „Ghandi“-Regisseurs Richard Attenborough, der Mitte der Fünfziger-Jahre des vergangenen Jahrhunderts die BBC-Bosse davon überzeugte, Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu filmen. So bannte er damals unvorstellbare Szenen mit Tieren auf Zelluloid – in schwarz-weiß auf Sechzehn-Millimeter-Film. Die ersten Naturfilme der BBC waren so erfolgreich, dass die BBC im Laufe der Jahre immer aufwändiger produzieren konnte. Zusätzlich befeuert durch die sich rasant entwickelnde Kameratechnik beschäftigte der Sender die besten Kameramänner, um Serien wie „Die Erde lebt“, „Abenteuer Wildnis“ oder „Das Leben der Vögel“ zu produzieren. „Der Blaue Planet“ wurde erstmals auf BBC One am 12. September 2001 ausgestrahlt, hierzulande in der ARD am 8. Juli 2003.

Schirmquallen bestehen zu 97 Prozent aus Wasser. Sie lassen sich von Strömungen treiben, können aber auch aktiv schwimmen. Bild: WDR/BBC NHU/Joe Platko

WDR-Intendant Tom Buhrow hält im Cinenova in Köln eine einführende Rede vor der Präsentation des ersten Teils der zweiten Staffel der Serie „Der Blaue Planet“
Großer Aufwand
Jetzt, sechzehn Jahre nach der ersten Staffel, geht es mit „Der Blaue Planet“ weiter. Die Crew konnte mit Hilfe weiter verbesserter Optik und Elektronik sowie völlig neuer technischer Entwicklungen noch nie gesehene, fantastische Szenen und Bilder einfangen. Die Produktionsdauer betrug vier Jahre. In diesem Zeitraum führten einhundertfünfundzwanzig Expeditionen die Teams auf jeden Kontinent und in jeden Ozean. Sie bereisten dabei neununddreißig Länder. Die Tauchteams hielten sich für die Produktion über sechstausend Stunden unter Wasser auf, wobei sie keinen Bereich ausließen. Sie erkundeten die Hochsee ebenso wie die Küstenbereiche. Der Vorstoß in die Tiefsee erforderte den Einsatz von Forschungs-U-Booten. Kamerateams verbrachten in diesen engen Hightech-Maschinen mehr als tausend Stunden. Sie entdeckten dabei so fremdartige Wesen, dass es schwer fällt, an einen Aufenthalt auf unserer Erde zu glauben, nur eben tausend Meter unter der Wasseroberfläche.
Von Stars ihrer Zunft geadelt
Tatsächlich wissen wir über die Tiefsee und das Leben in absoluter Dunkelheit sowie unter für Menschen extremen Druckverhältnissen sehr wenig. Während der Dreharbeiten für diese Serie sei jedoch eines mit erschreckender Deutlichkeit in Bewusstsein getreten: Der Gesundheitszustand der Meere, die eine herausragende Bedeutung für unser Klima und die Ernährung künftiger Generationen haben, ist stark gefährdet. Es sei von großer Bedeutung, die Ozeane umfassend zu erkunden, um herauszufinden, was aus unserem blauen Planet in naher und ferner Zukunft wird.
Die Musik zur Serie schrieb der aus Frankfurt stammende und in Hollywood arbeitende Filmkomponist Hans Zimmer, kein Unbekannter, hat er doch bereits mehr als einhundertzwanzig Filme mit seinen Kompositionen aufgepeppt. Seine Auszeichnungen können sich sehen lassen: Ein Oscar, zwei Golden Globes, drei Grammys, ein American Music Award, ein Tony Award, der Henry Mancini-Preis und der Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. In deutscher Sprache kommentiert wird der Blaue Planet von dem Schauspieler Axel Milberg. Er hat bereits zahlreiche Hörbücher besprochen und auch den Kino-Naturfilm „Magie der Moore“ von Jan Haft erklärend begleitet. Sein Kommentar zur neuen Staffel von „Der Blaue Planet“: „Kommen Sie mit auf diese unfassbare Reise! Sie brauchen dafür keine Sauerstoffflasche. Nur sechs mal fünfundvierzig Minuten Zeit und Neugier.“
Interview mit Axel Milberg
fotografie-report.de: Herr Milberg, wer hat sie darauf angesprochen, den erläuternden Kommentar zu „Der Planet Erde“ zu sprechen?
Axel Milberg: Die Redakteurin, glaube ich. Sie hat mich angerufen. Ich meine, sie hat mich als Sprecher in einem anderen Film gehört, möglicherweise in die „Magie der Moore“ von Jan Haft. Und das hat ihr gefallen.
fotografie-report.de: Mussten Sie erst nachdenken oder haben Sie sich spontan entschieden?
Axel Milberg: Ja, das war spontan. BBC, die Meere, das kannte ich, das fand ich ungewöhnlich, das hat mich sehr gefreut.
fotografie-report.de: Der Planet Erde wird ja in der Schweiz und in Österreich ebenfalls ausgestrahlt werden. Wissen Sie, ob Ihre Stimme auch da kommentieren wird?
Axel Milberg: Das weiß ich nicht.
fotografie-report.de: Ist für Sie das Thema Klimawandel, Welternährung, hier Ernährung aus dem Meer, eines, welches Sie besonders beschäftigt?
Axel Milberg: Oh ja, und das treibt uns ja alle um. Auch im privaten Bereich versucht man, sich richtig zu verhalten, dann wird man nachlässig, dann macht man es wieder besser, dann bringt man es den Kindern bei, und dann mahnt der Ehepartner. So sind wir. Wir sind nicht perfekt. Wir wissen es und es ist immer wieder eine kleine Annäherung. Im Übrigen ist eine nationale Lösung gar nicht möglich. Das ist ein globales Problem. Die Meere sind ja alle miteinander verbunden. Wir müssen einfach beginnen. Wir müssen die großen Organisationen unterstützen, wobei natürlich Geld einer Rolle spielt. Das fängt schon damit an, was wir kaufen. Das ist irre. Ich habe einen Freund aus Kinderzeiten. Der hatte eine Werft, deren Betrieb er vor zehn Jahren aufgeben musste, Er hat ein Schiff entwickelt, das diesen Plastikmüll einsammelt. Vor fünf oder sechs Jahren hat er mich darauf angesprochen. Ich habe mich immer bemüht, bei den reichen Leuten, denen ich manchmal begegne, für diese Idee zu werben, weil er einen Investor braucht. Aber es ist schwierig. Und auch die Politik in Deutschland ist da noch nicht so richtig aktiv geworden.
fotografie-report.de: Noch eine letzte Frage – würden Sie sich in einem solch winzigen Tauchboot in tausend Meter Tiefe oder mehr ohne Bedenken mitnehmen lassen?
Axel Milberg: Aber sicher, das würde ich sofort machen.
fotografie-report.de: Herr Milberg, vielen Dank.
Fotostrecke
- Mit dem Megadome, einem riesigem Kameragehäuse, lassen sich gleichzeitig Aufnahmen über und unter Wasser machen. Bild: WDR/BBC
- Vor Südafrika können gigantische Wellen entstehen. Bei den Dreharbeiten konnte die mächtigste Riesenwelle der letzten fünf Jahre gefilmt werden. Bild: WDR/BBC
- Walross-Mutter und Ihr Junges haben eine enge Bindung, sie kommunizieren durch Laute und mit Hilfe ihres starken Geruchssinns. Bild: WDR/BBC
- Walross-Babys können noch nicht so lange schwimmen, komfortable Rastplätze sind daher sehr begehrt. Bild: WDR/BBC
- Für diese Aufnahmen von Großen Tümmlern musste das Team wochenlang auf die optimalen Wellen und Delfingruppen warten. Bild: WDR/BBC
- Vor Neuseeland bilden Große Tümmler und Kleine Schwertwale Gemeinschaften, obwohl sie sich sonst überall spinnefeind sind. Bild: WDR/BBC/Richard Robinson
- Einige Große Tümmler sind dafür bekannt, sich mit der Schleimschicht von buschartigen Hornkorallen „einzureiben“, die antibiotische Substanzen enthält. Bild: WDR/BBC
- Große Tümmler auf Ausbildungstour. Die Eltern wollen dem Delfinkalb zeigen, wie es sich an Hornkorallen reiben kann, um die Haut zu schützen. Bild: WDR/BBC
- Per Laser soll ein Walhai vermessen werden. 20 Meter lang und 20 Tonnen schwer, ist er der größte Fisch in den Weltmeeren. Bild: WDR/BBC NHU/Jonathan Green
- In Deutschland wird die Grüne Meeresschildkröte auch Suppenschildkröte genannt, weil sie lange Zeit zur Herstellung von Schildkrötensuppe diente. Bild: WDR/BBC NHU/Jason Isley
- Bei Schafskopf-Lippfischen lassen sich Männchen und Weibchen sehr durch die Größe unterscheiden. Sind die Weibchen groß und alt genug, können sie eine beachtliche Verwandlung durchmachen: Sie werden vom Weibchen zum Männchen. Bild: WDR/BBC/Tony Wu
- Teufelsrochen sind als reine Plankton-Fresser bekannt, Doch in der Serie “Der Blaue Planet” wird zum ersten Mal gezeigt, dass sie auch Fische fressen. Bild: WDR/BBC NHU/Erik Beita Cortez
- Pottwale reisen häufig mit blinden Passagieren. Sogenannte Schiffshalter-Fische heften sich an und lassen sich über hunderte von Kilometern mitnehmen. Bild: WDR/BBC NHU/Franco Banfi
- Pottwal-Weibchen betreuen ihren Nachwuchs gemeinsam im Team, in sogenannten Kindergärten. Bild: WDR/BBC NHU/Tony Wu
- Buckelwale ziehen erst seit kurzem bis in die Fjorde Nord-Norwegens. Große Heringsschwärme locken sie dort an. Bild: WDR/BBC/Audun Rikardsen
- Eine Dickkopf-Stachelmakrele auf Patrouille in flachen Lagunen-Gewässern. Sie wartet auf Vogelküken, die erste Flugübungen über dem Wasser machen. Bild: WDR/BBC
- Dickkopf-Stachelmakrelen können bei ihrer Jagd auf Jungvögel sogar aus dem Wasser springen. Bild: WDR/BBC
- Als einzige unter den Riff-Fischen benutzen Großzahn-Lippfische Werkzeuge, um die harte Schale von Muscheln, ihrer Lieblingsbeute, zu knacken. Sie schlagen die Muschel immer wieder gegen einen Korallenstock, bis die Schale bricht. Bild: WDR/BBC/Alex Vail
- Der Pfannkuchentintenfisch lebt in der kalifornischen Tiefsee. Seine Kopfflossen haben ihm den Spitznamen „Dumbo“-Tintenfisch eingetragen. Bild: WDR/BBC
- Der Breitarm-Sepia Tintenfisch ist auf Krabben spezialisiert. In schnellem Rhythmus lässt er Muster über seinen Körper flackern. Das scheint Krabben in Trance zu versetzen, so dass sie leichter zu fangen sind. Bild: WDR/BBC NHU/Justin Hofman
- Gelbflossen-Thunfische gehören zu den schnellsten Fischen der Meere. Geschwindigkeiten von 60 Kilometern pro Stunde sind keine Seltenheit. Bild: WDR/BBC NHU/David Valencia
- Die giftige Portugiesische Galeere sieht aus wie eine Qualle, aber hier tun sich Tausende von Nesseltierpolypen zwecks Arbeitsteilung zusammen. So bilden sie z. B. ein Segel, mit dessen Hilfe sie sich übers Meer treiben lassen. Bild: WDR/BBC NHU/Matty Smith
- Ein Sechskiemerhai auf dem Weg zu einem Walkadaver. In der Tiefsee zählt jede Kalorie, hier herrscht Nahrungsnotstandgebiet. Die großen Haie haben einen sehr langsamen Stoffwechsel und können in der Kälte der Tiefsee ein Jahr ohne Futter aushalten. Das Foto wurde im Tauchboot ‚Lula‘ der Rebikoff-Niggeler-Stiftung aufgenommen. Bild: WDR/BBC NHU/Will Ridgeon
- Der in der Tiefsee vorkommende Fangzahnfisch hält einen Rekord unter Fischen: Er hat im Vergleich zu seinem Körper die größten Zähne. WDR/BBC NHU/Espen Rekdal